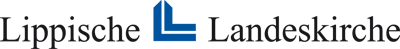Wo staatliche Strukturen nicht greifen
Marktplatzgespräch in Detmold zur Entwicklungszusammenarbeit mit internationalen Fachleuten
Aber auch hierzulande machen massive Kürzungen staatlicher Mittel den Verantwortlichen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund hatte die Lippische Landeskirche zum Marktplatzgespräch ins Gemeindehaus der Erlöserkirche Detmold eingeladen: „Quo vadis Entwicklungszusammenarbeit?“ lautete das Thema. Sabine Hartmann, Referentin für ökumenisches Lernen und Dieter Bökemeier, Landespfarrer für Diakonie, Ökumene und Migration, moderierten die Diskussion.
Um 1965, als viele Kolonien in Afrika unabhängig wurden und die Bundesrepublik einen Wirtschaftsaufschwung erlebte, setzte Entwicklungshilfe von Nord nach Süd in größerem Maßstab ein, erklärte Sabine Hartmann. Sie sei noch sehr paternalistisch ausgerichtet gewesen: Die reichen Geber glaubten besser als die Empfänger zu wissen, was für diese das Beste wäre. Seit den 1990er Jahren zeichnete sich ein Wandel ab: Man wollte nun partnerschaftlich, „auf Augenhöhe“, miteinander umgehen. Entwicklungshilfe wurde zur Entwicklungszusammenarbeit, in der Staat und Kirche kooperieren. Es geht zum Beispiel um Ernährungssicherung, Bildungsarbeit und Zugang zu Wasser.
Kirche und Staat hätten jeweils eigene Stärken, die sie gemeinsam effektiv nutzen könnten, sagte Dr. Paul Berbée vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). So verfügten die Kirchen in den Ländern des Globalen Südens über ganz besondere Verbindungen: „Sie können damit Menschen erreichen und etwas bewirken, wo staatliche Strukturen nicht greifen.“ Berbée, der im BMZ für die Zusammenarbeit mit den Kirchen und ihren Entwicklungsorganisationen zuständig ist, nannte als staatliche Stärke die Projektfinanzierung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Doch auch über rein finanzielle Hilfe hinausgehende Ziele wie die Förderung von Menschenrechten und Geschlechtergerechtigkeit bestimmten heute die Arbeit des BMZ.
Vieles, wie der Bau von Schulen und Krankenstationen, sei ohne Unterstützung aus dem Norden nicht möglich, berichtete der aus dem westafrikanischen Benin stammende Rachidi Houndonougbo. Neun der zehn am wenigsten entwickelten Länder weltweit lägen auf dem afrikanischen Kontinent. Houndonougbo ist Erziehungswissenschaftler und arbeitet in Bielefeld-Bethel. Er beschrieb ein Beispiel eines gelungenen Kleinprojekts aus Benin, wo mit Unterstützung der ganzen Dorfgemeinschaft eine Schule gebaut wurde. Er übte aber auch Kritik an der gegenwärtigen Entwicklungszusammenarbeit: Sie stehe immer in Gefahr, die armen Länder des Südens letztlich in Abhängigkeit zu halten. So seien 2023 weltweit zwar 223 Milliarden geflossen, doch gleichzeitig 921 Milliarden für Schuldenrückzahlungen fällig geworden.
Die Theologin Ailed Villalba Aquino vom Oikos-Institut (Dortmund) der Evangelischen Kirche von Westfalen berichtete aus Sicht der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit. Zentral für den kirchlichen Ansatz zum Beispiel von Brot für die Welt sei, dass immer mit lokalen NGOs (Nichtregierungsorganisationen) zusammengearbeitet würde. Als Beispiel beschrieb sie Projekte in Peru, bei denen sehr basisnahe Lösungen für Probleme gefunden wurden. Aquino wies aber auch auf größere wirtschaftliche Zusammenhänge hin und kritisierte Pläne, das deutsche und europäische Lieferkettengesetz wesentlich zu entschärfen, da hierdurch Armuts- und Ungerechtigkeitsstrukturen im Globalen Süden zementiert würden. Sie machte zudem auf ein weiteres Problem aufmerksam: Denn neben den staatlichen Einschnitten, die die Arbeit von Organisationen wie Brot für die Welt betreffen, gebe auch der Rückgang der kirchlichen Finanzen Anlass zur Sorge. Es dürfe nicht dazu kommen, dass Solidarität mit den Ländern des Globalen Südens als nachrangig angesehen würde gegenüber anderen Kernaufgaben der Kirche bei uns.